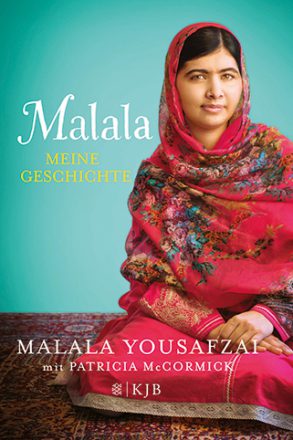„Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern.“ Mit diesem Satz beendete 2013 an ihrem 16. Geburtstag Malala ihre Rede vor den Vereinten Nationen. Dass sie dort sprechen und 2014 den Friedensnobelpreis als Aktivistin für das Recht jeden Kindes auf Bildung in Empfang nehmen konnte, glich einem Wunder. Als Malala 15 war, schossen die Taliban sie nieder, denn: Seit Januar 2009 berichtete die bekennende Muslima und Angehörige des Volkes der Paschtunen über die BBC in einem Blog über Verbote und Gewalttaten der pakistanischen Taliban. So wurde Malala zur Zielscheibe.
Doch wie wächst ein Mädchen unbeugsam und selbstbewusst in einem Land auf, in dem niemand die Geburt eines Mädchens feiert und Mädchen nicht in den Familienstammbaum gehören? Wo Mädchen aufgrund der Geschlechtertrennung höchstens Lehrerinnen und Ärztinnen, aber keine Anwältinnen, Ingenieurinnen, Modedesignerinnen oder Künstlerinnen werden können? Anfangs wollte Malala – laut vorliegender Autobiographie – Ärztin werden, heute Politikerin. Malala scheint unerbittlich, wenn sie selbst US-Präsident Obama für den Drohnenkrieg in Pakistan kritisiert und die dabei verwendeten Milliarden lieber für Bildung ausgegeben sehen will.
Diese Selbstbestimmtheit verdankt sie ihrem Vater. Der „kümmerte sich nicht um Gepflogenheiten“, sondern trug den Namen Malala mit leuchtend blauer Tinte ins Familienstammbuch ein. Laut Malala war es „der erste weibliche Name seit 300 Jahren“. Der Vater, Leiter einer Privatschule, unterstützte den unbändigen Lernwillen der Tochter, kämpfte unermüdlich gegen die Taliban, beteiligte Malala daran und stand selbst auf der Abschussliste.
In ihrer „Geschichte“, welche Patricia Mc Cormick half aufzuschreiben, stellt Malala sich nicht als Heldin aus, sondern erzählt von sich als einem Mädchen, das in einer religiösen Familie aufwuchs, in der Weltwissen eine wichtige Rolle spielt und in der über Politik und Religion gestritten wird. Aber auch kulturell Übergreifendes, Alltägliches kommt zur Sprache: ständiger Zank mit den Brüdern, Streit und Versöhnung mit Freundinnen, der Ehrgeiz, immer Beste sein zu wollen oder die Vorliebe für Pink.
Gerade dieses „Normale“ rückt die Erzählerin nah an die Leser heran. Niemand ist von Geburt an eine Malala, wenige werden es, aber Haltungen und Positionierungen werden jedem abverlangt. „Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern“, davon ist die jetzt in Großbritannien lebende 18-jährige zutiefst überzeugt und gründete eine nach ihr benannte Stiftung (malalafund.org), in welche sie ihre Preisgelder einbrachte.
(Der Rote Elefant 33, 2015)